Die Maßnahmen zur Umgestaltung der Wirtschaft in der Europäischen Union laufen auf Hochtouren. Man sollte keine Zeit mehr verlieren, sich damit auseinanderzusetzen, da die neuen Regelungen alle Branchen betreffen werden.
Der European Green Deal, den die Europäische Kommission Ende 2019 erstmals vorgestellt hat [Mitteilung KOM (2019) 640 endg], ist ein Teil eines größeren und globalen Trends, der zunehmend Wert auf nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten legt. Nachhaltigkeit wird mit den Begriffen Environmental (E), Social (S) und Governance (G), zusammen kurz: ESG, umschrieben. Beispiele für die wachsende Bedeutung des S sind auf europäischer Ebene die Konfliktmineralien-Verordnung sowie auf deutscher Ebene das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Aktuelle Beispiele für eine größere Gewichtung des G sind auf europäischer Ebene die EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern und auf nationaler Ebene unter anderem das Zweite Führungspositionen-Gesetz. Fahrt aufgenommen hat aber vor allem – auf globaler Ebene das E. In der EU hat die umweltbezogene Nachhaltigkeit durch den EU-Aktionsplan Finanzierung nachhaltigen Wachstums 2018, die EU-Taxonomie-Verordnung sowie der European Green Deal aus dem Jahr 2020 und das darauf aufbauende Maßnahmenpaket Fit for 55 an Bedeutung gewonnen. In Deutschland ist die Neuauflage des Bundes-Klimaschutzgesetzes als Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von April 2021, das in Bezug auf das Bundesklimaschutzgesetz die fehlenden Emissionsminderungsvorgaben ab 2031 bemängelte, herauszuheben.
Grundlagen des European Green Deal
Herzstück der EU-Maßnahmen ist der European Green Deal, dessen Hauptziel es ist, dass Europa im Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent ist. Er bildet gleichzeitig einen zentralen Bestandteil der EU-Strategie zur Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (A/RES/70/1). Der Green Deal soll eine Antwort auf die entscheidenden klima- sowie umweltbedingten Herausforderungen – insbesondere Klimawandel, Artensterben und Meeresverschmutzung – geben und Europa auf einen neuen Weg zu nachhaltigem und integrativem Wachstum bringen. Er sieht eine Umgestaltung der EU-Wirtschaft sowie einen Europäischen Klimapakt vor, womit sich die EU als weltweiter Vorreiter positionieren möchte. Alle gesetzgeberischen Maßnahmen und Strategien der EU sollen künftig zur Verwirklichung des European Green Deal beitragen und sich in ihren Auswirkungen daran messen lassen.
Erklärte Ziele
Die Kommission versteht den European Green Deal als Wachstumsstrategie, mit der folgende Ziele in der EU erreicht werden sollen:
- ambitioniertere Klimaschutzziele bis 2030 und 2050
- Versorgung mit sauberer, erschwinglicher und sicherer Energie
- Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft
- energie- und ressourcenschonendes Bauen und Renovieren
- Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt
- Ökosysteme und Biodiversität erhalten und wiederherstellen
- faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem
- raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität
Das zentrale Element des European Green Deal ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent anstatt der bisherigen 40 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 und erreichte Klimaneutralität bis 2050.
EU-Taxonomie-Verordnung
Der Green Deal berücksichtigt, dass neben gesetzgeberischen und regulatorischen Maßnahmen große finanzielle Mittel benötigt werden. Für die Umsetzung des European Green Deal veranschlagt die EU-Kommission einen Bedarf von 1,8 Billionen Euro. Der Finanzbedarf für den Umbau der EU-Wirtschaft soll auf zwei wesentlichen Säulen beruhen. Zum einen ist dies die Bereitstellung finanzieller Mittel durch die EU beziehungsweise durch nationale Stellen sowie auf der anderen Seite – quasi als Ergänzung dieser staatlichen Aufwendungen – die Umlenkung von privatem Kapital in nachhaltige Geschäftsaktivitäten sowie Investitionen in Klima- und Umweltmaßnahmen. Zu diesem Zweck führt die EU-Taxonomie-Verordnung (EU 2020/852) als Teil des EU-Aktionsplans Finanzierung nachhaltigen Wachstums ein EU-weites Klassifizierungssystem ein, um die ökologische Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten zu bestimmen, mit dem Ziel, die Bereitstellung von Finanzmitteln in die als nachhaltig definierten Aktivitäten zu steuern. Die Wechselwirkung zwischen der EU-Taxonomie-Verordnung und dem European Green Deal war zuletzt an dem stark diskutierten Vorschlag der EU-Kommission, wonach Investitionen in Kernkraft und Gaskraftwerke als nachhaltig gelten können, zu erkennen. Während die EU-Taxonomie-Verordnung bezogen auf das Geschäftsjahr 2021, bereits erste Offenlegungspflichten vorsieht, befindet sich die konkrete Umsetzung des Green Deal noch auf dem Weg.
Umsetzung der Ziele und Schwerpunkte
Die EU-Kommission hat nach der Veröffentlichung verschiedener Einzelstrategien (Offshore Renewable Energy, Industry Strategy, Hydrogen Strategy) erst mit dem Europäischen Klimagesetz (EU 2021/1119), das am 30. Juni 2021 in Kraft trat und die Verringerung der Netto-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent festschreibt, den relevanten Startschuss für die Realisierung des Green Deal gegeben. Zur Umsetzung hat am 14. Juli 2021 die EU-Kommission das Maßnahmenpaket Fit for 55 vorgestellt. Der Übergang zu einem klimaneutralen Kontinent soll fair und sozial gerecht erfolgen, gleichzeitig sollen Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in den EU-Ländern geschützt und gestärkt werden; dies zudem unter Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen gegenüber den Akteurinnen und Akteuren aus Drittländern. Erreicht werden sollen die verschärften Klimaziele durch marktorientierte und ordnungsrechtliche Maßnahmen sowie der bereits erwähnten Steuerung privater Gelder in nachhaltige Investitionen.
Eine Fülle an Vorhaben
Von den im Paket Fit für 55 des Rats der EU enthaltenen Gesetzgebungsvorschlägen und politischen Initiativen sind besonders hervorzuheben:
- die Festlegung neuer Emissionsreduktionsziele (Sektorziele) der Mitgliedstaaten
- die grundlegende Überarbeitung des Emissionshandelssystems als Kernsteuerungselement (unter anderem Aufnahme der Sektoren Wärme und Verkehr)
- die grundlegende Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie sowie der Energieeffizienzrichtlinie und des Gasbinnenmarktpakets
- die Einführung spezifischer Regelungen für Wasserstoff
- die Förderung des Ausbaus von CO2-Senken durch die EU-Waldstrategie
- die Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe
Große Wirkung für den Handel hat das CO2-Grenzausgleichssystem (Carbon Border Adjustment Mechanism), das zur Verhinderung von Carbon Leakage Produkte im Fokus hat, die in die EU eingeführt werden. Abgefedert werden sollen die zu erwartenden Mehrkosten für sozial schwächere Haushalte, Kleinunternehmen und Verkehrsteilnehmer durch einen Klimasozialfonds, in den Einnahmen aus dem erweiterten Emissionshandel einfließen sollen.
Besonders betroffene Branchen
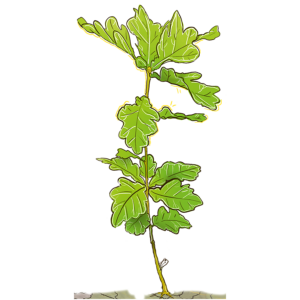
Die zur Umsetzung des Green Deals überarbeiteten beziehungsweise neu erlassenen Regelungen werden sich auf alle Branchen auswirken. Es ist kaum eine Branche zu verzeichnen, für die das Maßnahmenpaket keine Auswirkungen haben wird. Zu erwarten ist jedoch eine besonders starke Betroffenheit des Verkehrssektors (Straße, See, Flug), des Immobilien-, Bau- und Wärmesektors, der Land- und Forstwirtschaft und natürlich erwartungsgemäß der Energiewirtschaft.
Umsetzungsstand Die Umsetzung des European Green Deal durch das Fit-for-55-Maßnahmenpaket läuft auf Hochtouren. Erste konkrete Vorschläge sind auf dem Weg. Bis die Vorschläge der EU-Kommission den legislativen Prozess durchlaufen haben beziehungsweise umgesetzt werden, vergehen im Regelfall 18 bis 24 Monate. Allerdings stehen die zu erreichenden Nettotreibhausgasemissionen der EU bereits fest. Wie der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz feststellte, müsse Deutschland die Geschwindigkeit der Emissionsminderung verdreifachen, was für unser industriell geprägtes Land eine sehr große Herausforderung ist.




