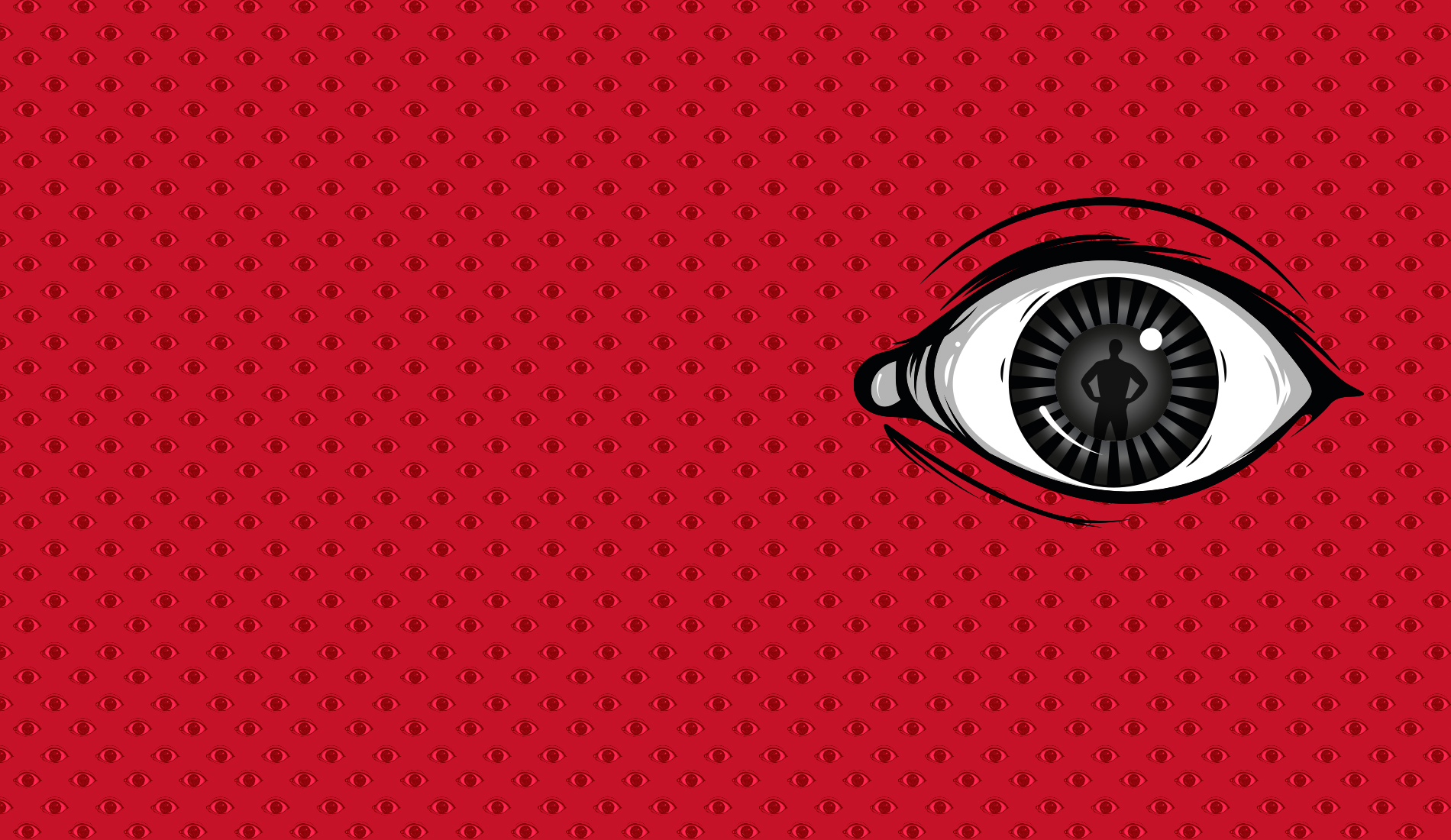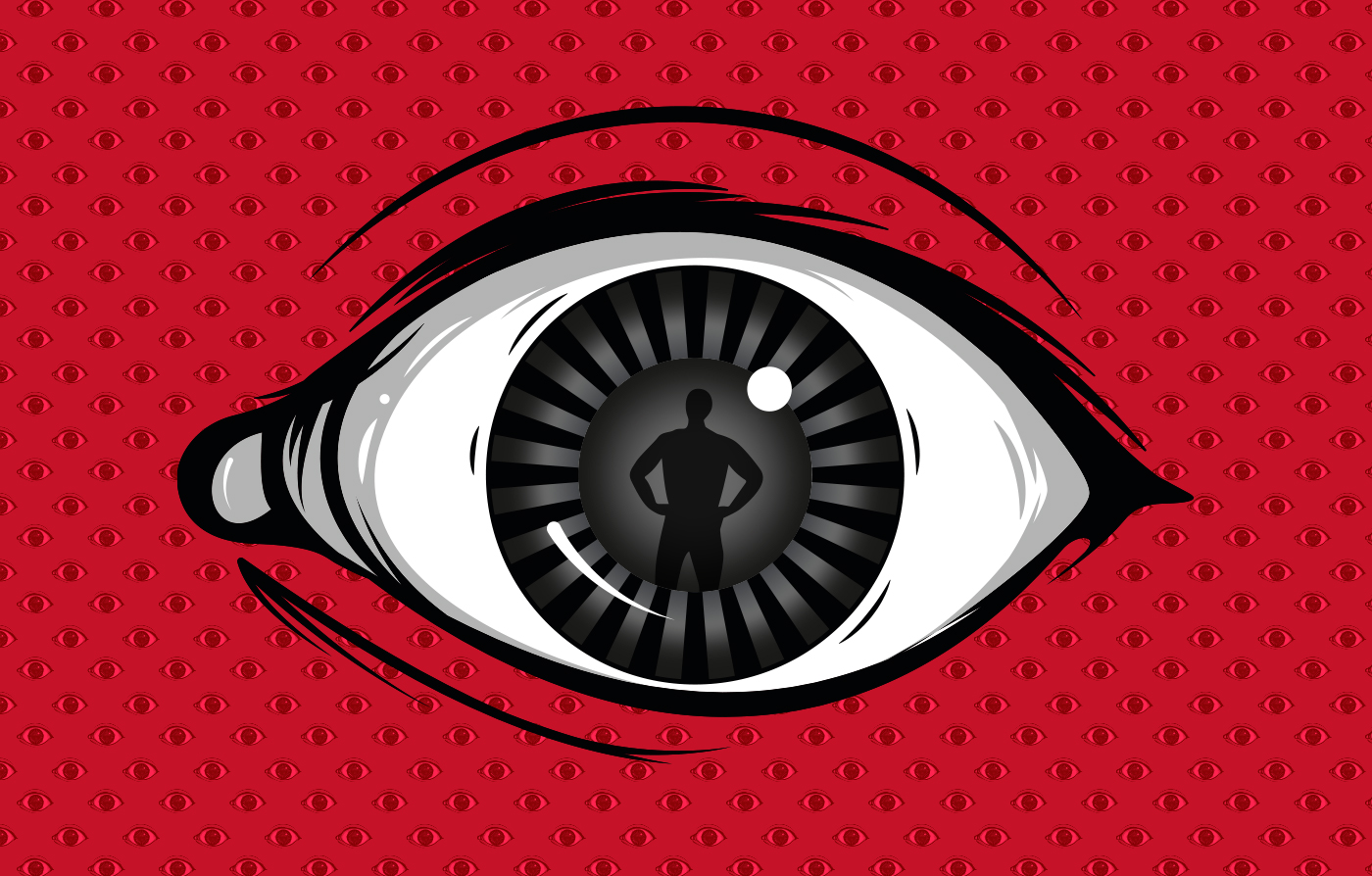Es ist eine Binse und doch lohnt es sich, ihr einmal nachzusinnen: Die Gratiskultur im World Wide Web ist in Wahrheit gar keine – wir bezahlen mit unseren Daten, einer durchaus werthaltigen Währung – freilich nicht für uns, aber für andere.
Dass wir bei buchstäblich allem, was wir tun, wenn wir Apps nutzen, uns auf Webseiten bewegen, googeln oder in den sozialen Medien unterwegs sind, Spuren hinterlassen, die akkumuliert, ausgewertet und zu einem Persönlichkeitsprofil verdichtet werden können, ist hinlänglich bekannt. Das Verhalten und die innere Einstellung des Einzelnen diesem Umstand gegenüber sind allerdings höchst unterschiedlich und keineswegs auf nur einer einzigen Skala – etwa von missfällt mir bis ist mir egal zu verorten. Da gibt es explizite Befürworter, die Privatheit für antiquiert halten, es gibt Einsichtige, denen klar ist, dass der Content und seine Bereitstellung finanziert werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es die Resignierten, die sich ins Unvermeidliche fügen, die Besonnenen, die sich genau überlegen, was sie preisgeben, die Vorsichtigen, die mit vielen Konten und Identitäten ihre wahre Identität zersplittern, um unkenntlich zu bleiben, es gibt Verschwörungstheoretiker, und es gibt natürlich auch die Kriminellen, die besondere Gründe haben, alles zu verschleiern, was auf ihre wahre Person hinweist.
Respekt für das immateriell Eigene
Geschichtlich neu ist hierbei der Umstand, dass nicht mehr das Private und das Öffentliche als gegensätzliche Pole zueinander in Opposition stehen, sondern das Private sich etwas Undurchschaubarem und gänzlich Unkontrollierbarem gegenüber sieht, das es lautlos aushöhlt, ja geradezu auflöst. Was genau ist jenseits eines allgemeinen Unbehagens eigentlich das Ungute daran, welches Rechtsgut steht hier auf dem Spiel? Unsere Gesellschaft hat sich darauf verständigt, dass es ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, aus dem sich alles ableitet, was es hier zu verhandeln gilt. Schon das ist nicht selbstverständlich. Nicht nur Diktaturen enthalten ihrem Staatsvolk dieses Recht vor, auch gemäßigtere und demokratisch legitimierte, wenn auch autoritäre Regime wie etwa in Singapur achten dieses Rechtsgut nicht eben hoch, und das unter weitgehender Zustimmung der Staatsbürger. Die Frage, welchen Anspruch auf Respektierung auch des immateriell Eigenen das Individuum gegenüber der Gemeinschaft hat, in der es lebt, und umgekehrt: Welches Anrecht das Kollektiv gegenüber dem Einzelnen auf umfassenden Einblick und – gegebenenfalls – auf Kontrolle seines Sozialverhaltens hat, diese Frage wird auf dieser Welt höchst unterschiedlich beantwortet und immer wieder neu verhandelt. In skandinavischen Ländern etwa ist die Sitte, Fenster mit Vorhängen auszustatten, weit weniger verbreitet als hierzulande, das Bedürfnis, eigenes Tun und Lassen den Blicken der Nachbarn zu entziehen, ist dort weit weniger ausgeprägt. Und auch hier ist es gerade mal 50 Jahre her, dass das Private – wenn auch unter vollkommen anderem Vorzeichen – unter Generalverdacht geriet, nämlich den einer bourgeois-konterrevolutionären Verweigerungshaltung. Motto: Das Private ist politisch! Die Aberkennung eines Anspruchs auf das Eigene, Ungeteilte trieb seinerzeit höchst wunderliche Blüten und führte unter anderem dazu, dass in der legendären Kommune 1 zeitweise die Toilettentüren ausgehängt wurden. Nichts, absolut nichts sollte der allgemeinen Anteilnahme entzogen werden können; jedwede Privatsphäre und damit auch das mit einer Entblößung einhergehende Schamgefühl waren verdächtig, ein Habitat und heimlicher Rückzugsort überkommener bürgerlicher Affekte und eine Brutstätte faschistoider Gesinnungen zu sein.
Die Kapitulation ist da …
Heute steht das Private wieder einmal zur Disposition, wenn auch durch Selbstaufgabe und insofern unter neuerlich gewandeltem Vorzeichen. Michal Kosinski, Jahrgang 1982, Professor in Stanford und zuvor in Cambridge, beschäftigt sich seit Jahren mit digitaler Psychometrie, der Frage also, inwieweit die Spuren, die wir in Gestalt unseres Surfverhaltens und namentlich unseres Verhaltens in den sozialen Netzwerken hinterlassen, Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit gestatten: auf unsere Einstellungen und unsere Entscheidungen. „Wir gehen“, so seine klare Ansage, „in eine Zukunft, in der es wenig oder gar keine Privatsphäre gibt, und je eher wir das anerkennen und unsere Welt so entwerfen, dass sie immer noch schön und sicher ist, desto besser.“ Nun ist das Bestreben der Psychologie, zu ergründen, was sich hinter dem Rücken unseres intentionalen Bewusstseins abspielt, wenn wir Entscheidungen treffen oder bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, nicht neu, und das Methodenrepertoire, um dies herauszufinden, schon lange ausdifferenziert. Neu ist jedoch, dass es dazu nicht mehr der aktiven Mitwirkung und des Einverständnisses des Probanden bedarf, sich Tests zu unterwerfen oder Fragebögen auszufüllen. Die Algorithmen, die Kosinski in seiner Zeit in Cambridge entwickelt und deren Treffsicherheit er mit Freiwilligen untersucht hat, gestatten die Erstellung genauer Persönlichkeitsprofile allein aus unserem Verhalten im Netz, das von den Anbietern der Seiten, auf denen wir uns bewegen, weitgehend mitprotokolliert wird. Sein in Cambridge entwickeltes Tool Apply Magic Sauce ist öffentlich zugänglich (https://applymagicsauce.com/demo). Hier kann jedermann ausprobieren, was die Summe seiner Statements auf Facebook, Twitter und LinkedIn über ihn aussagt.
Und inzwischen sind die Algorithmen natürlich schon viel weiter, dringen wesentlich tiefer in die Persönlichkeitsstruktur vor. Es endet nicht damit, über den Musikgeschmack etwa das Geschlecht des Probanden zu identifizieren (Trefferquote mehr als 90 Prozent) oder pauschale Erkenntnisse zu gewinnen wie die, dass Simpsons-Fans im Kern wertkonservativ sind und wer Dexter schaut, gut organisiert und ordentlich ist bis hin zur Pedanterie. Es geht viel weiter: Kosinski und sein Team haben beispielsweise herausgefunden, dass statistisch gesehen bereits zehn Facebook-Likes genügen, um einen Menschen zuverlässiger einschätzen zu können als die Arbeitskollegen es vermögen. 68 Facebook-Likes reichen, um verlässliche Aussagen über die Hautfarbe, sexuelle Orientierung, politische Ausrichtung einer Person zu gewinnen sowie darüber, ob deren Eltern bis zu ihrem 21. Lebensjahr zusammen waren oder nicht. 70 Likes sagen mehr über uns aus als Freunde von uns wissen, 150 Likes überbieten den Kenntnisgrad der eigenen Eltern, und auf Basis von 300 Likes kann das Tool einen Menschen genauer einschätzen als der Lebenspartner es vermag.
… aber noch sind wir Verschonte
Nun kann einem angesichts solcher Aussichten bange werden, allerdings dürfen wir nicht vergessen: Hier legt kein Team von Detektiven ein Dossier über uns an (auch wenn das theoretisch jederzeit möglich wäre), sondern es sind lediglich Algorithmen am Werk, die uns – bestenfalls – treffsicher personalisierte Werbung zuspielen. Problematisch ist freilich, dass damit die Tür zu einer neuen Form von werblicher Manipulation aufgestoßen worden ist, die angeblich im US-Wahlkampf auch bereits zum Einsatz gekommen ist: in Gestalt ganz bestimmter Wahl-Spots, die zielgenau auf das Mindset der Adressaten abgestimmt und entsprechend produziert worden sind. Im Lichte all der neuen Möglichkeiten einer maximal individualisierten, psychologisch optimierten Ansprache ist es erstaunlich, dass bei deren Umsetzung augenscheinlich noch weitgehende Zurückhaltung geübt wird. Aber machen wir uns keine Illusion: Sie wird kommen.